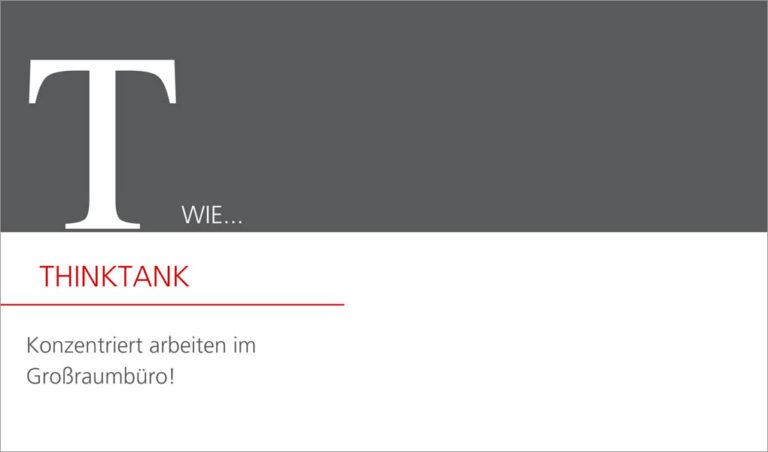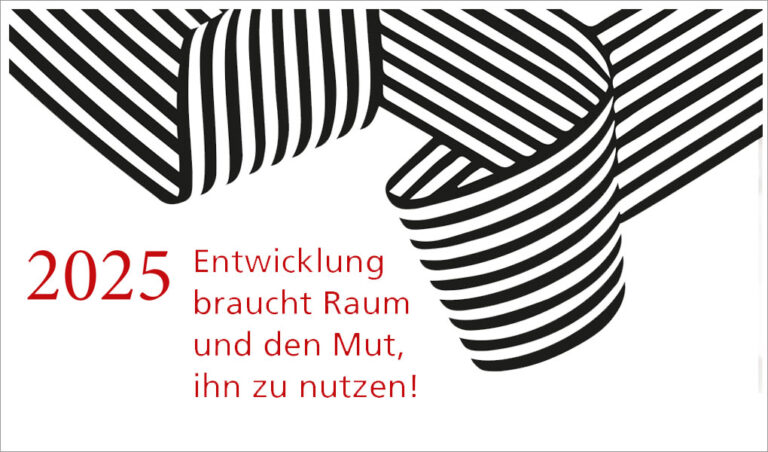Lange, dunkle Flure, Einzel- und Doppelbüros, geschlossene Türen, eine winzige Teeküche: So sieht eine völlig unzeitgemäße Bürowelt aus. Dem Abriss geweiht? Ein Umbau zu aufwändig?
In Zellenbüros steckt mehr Potenzial, als man denkt. Das Gegenmodell der offenen Bürolandschaft hat nämlich auch seine Tücken. Häufig fehlen den Mitarbeitenden Rückzugsorte. Sie fühlen sich beobachtet und durch Telefonate beeinträchtigt oder wollen ihrerseits die Kollegen und Kolleginnen nicht stören. Raumakustik und Vertraulichkeit sind immer wieder wichtige Themen, auf die wir als Planungsbüro stoßen. Studien haben gezeigt, dass die Teams in Großraumbüros viel mehr chatten als zu sprechen. Wiederum nehmen häufig Personen im Großraumbüro am selben Videocall teil und klagen über technische und akustische Unzulänglichkeiten anstatt sich in einem gesonderten Besprechungsraum persönlich zu begegnen und Außenstehende hybrid dazuzuholen.
Wie kann man also vorteilhaft moderne Arbeitswelten in Zellenstrukturen umsetzen?
1. Die Zellenstrukturen als gebaute Raumakustik begrüßen
In großen Büroflächen werden Rückzugsorte und Besprechungsräume aufwändig eingebaut: Als eingestellte Glaskisten und preisintensive Telefonkabinen, mit teuren Akustikvorhängen oder fest als Trockenbau-Box. Das sieht zwar meist schick aus, in Zellenstrukturen ist der Rückzugsort aber bereits fertig. Ein ehemaliges Einzelbüro kann ganz leicht ein Thinktank oder kleiner vertraulicher Meetingraum werden. Eine schmale Teeküche ohne Fenster wird vielleicht zu einem Lager für Büromaterial oder ein gemeinsames Aktenarchiv. In den Arbeitsräumen gilt dann: „Tür auf“ oder „Tür zu“ – Ein Zeichen, das intuitiv genutzt werden kann für Vertraulichkeit oder als einladende Geste zum Austausch.
2. Kommunikation entsteht durch Bewegung: Activity-based Working
Zellenbüros mit festen Arbeitsplätzen sind umstritten, weil man sich wenig begegnet und spontaner Austausch kaum stattfindet. Activity-based Working bedeutet aber, dass man den Arbeitsplatz am Tag häufiger wechselt, nämlich entsprechend den Anforderungen der jeweiligen Aufgaben. Dafür ist es nötig, definierte Raumtypen einzurichten. Durch die Bewegung zwischen diesen Räumen entsteht dann Kommunikation (und auch ein kleiner sportlicher Impuls!). Hilfreich ist die Verknüpfung mit Desksharing und Buchungssystemen, aber auch eine ganz freie Nutzung kann möglich sein.
Hier einige Beispiele für Raumtypen:
PIANO – Konzentrierte Stillarbeit
In solchen Räumen ist das Smartphone stumm; Telefonieren und Videocalls sind nicht erlaubt. Stillarbeitsbereiche dienen der konzentrierten Fokusarbeit, z.B. für das Verfassen von Berichten oder Strategie-Exposés, für Abrechnungen, Vertragsprüfungen, tiefgründiges Lesen usw. Je nach Absprache sind auch Online-Schulungen möglich, wenn die teilnehmende Person nur per Kopfhörer zuhört. Da alle Personen leise sind, müssen eigentlich keine besonderen Vorkehrungen für die Raumakustik getroffen werden. Eine gedämpfte Akustik und ein hochfloriger Teppich reduzieren jedoch auch alle anfallenden Restgeräusche und den Trittschall und erzeugen eine Bibliotheksatmosphäre, die wiederum zum Leise-sein anregt. Schreibtischpaneele und umgrenzte Arbeitsplätze können zusätzlich visuelle Ablenkungen vermeiden und die Fokusarbeit unterstützen.
Piano-Bereiche werden am besten entfernt von Treffpunkten und hochfrequentierten Verkehrszonen in ruhigen Bereichen angeordnet.
MEZZO – die tägliche Büroarbeit
Diese Bereiche sind mit Standard-Arbeitsplätzen eingerichtet und erlauben einen Mix aus Bildschirmarbeit, kurzen Telefonaten und auch Ad-hoc-Absprachen im Team. Hier sollten die Mitarbeitenden gemeinsam Regeln festlegen: Ab welcher Länge eines Plauschs oder Telefonats sollte man lieber den Raum verlassen oder eine Telefonbox nutzen? Sind Stehtische oder Couch-Ecken im Büro gewünscht für kurze Absprachen oder stört das eher? Welche Art von Video-Call kann im Büro durchgeführt werden und wann suche ich mir dafür einen speziellen Raum?

FORTE – Besprechungen und Videocalls
Forte-Räume sind per se Räume für den lauten Austausch. Dazu gehören klassische Konferenzräume, vertrauliche Besprechungsräume, agile Workshopbereiche und Cafeterien. Aber auch spezielle Räume für das häufige Telefonieren und für Videocalls können so kategorisiert werden. Dann sollte die Möblierung darauf reagieren.
Wie in einem Call-Center sind die Arbeitsplätze akustisch möglichst gut abgeschirmt und stehen eventuell so, dass die Sprecher:innen voneinander abgewandt sind. Hilfreich sind auch gute Headsets und Noise-Cancelling-Kopfhörer. Sehr häufig wurde uns mitgeteilt, dass weniger die sprechenden Kolleg:innen störend sind. Vielmehr muss unbedingt vermieden werden, dass die zuhörende Person am anderen Ende der Leitung merkt, dass noch andere Menschen im Raum sprechen. Damit soll Vertraulichkeit und Diskretion beim Gespräch vermittelt und gewährleistet werden. Dies ist insbesondere bei Gesprächen mit Mandant:innen oder im Recruiting relevant. Auch hierfür gibt es technische Lösungen.
Thinktank – Einzelarbeitsplatz
Einige kleine Büros mit einzelnem Schreibtisch können für spezielle Anforderungen genutzt werden: Vertrauliche Personaltelefonate, hochkonzentriertes Arbeiten mit vertraulichen Dokumenten o.ä. Solche Büros haben meist auch Platz für eine kleine Sofa-Ecke oder einen Besprechungstisch. So kann der Raum z.B. gebucht werden, wenn mehrere Personalgespräche hintereinander stattfinden und man immer wieder zwischendurch in digitale Unterlagen schauen möchte. Ist der Raum nicht gebucht, können die Meetingmöbel für eine Ad-hoc-Besprechung, ein schnelles Telefonat oder auch eine Pause genutzt werden.
Mit einem psychologischen Trick lässt sich verhindern, dass das Büro schleichend zum festen Arbeitsplatz wird: Der Schreibtisch wird nahe der Tür positioniert und die Zusatz-Sitzecke eher am Fenster. Das ist ein klein wenig „ungemütlicher“ und markiert den Raum als temporären Arbeitsplatz.
Projektbüros – zeitweise gemeinsam
In manchen Firmen kann es sinnvoll sein, im Team einen Raum für die Kooperation über einen längeren Zeitraum zu buchen. Wird eine Marketing-Strategie oder ein neues Produkt entwickelt, muss der Jahresabschluss erarbeitet werden oder wird ein Messeauftritt vorbereitet? Dann kann in Projekträumen jeder seinen Arbeitsplatz für längere Zeit belegen, das Projektteam direkt daneben am eigenen Stehtisch zusammenkommen und an Whiteboards und Pinnwänden Ideen entwickeln sowie Notizen und Zeitpläne hängen lassen. Auch ein Bildschirm mit Hybrid-Ausstattung ist sinnvoll für Präsentationen und Meetings mit Externen.
Überlaufflächen
Wenn Zellenbüros umgewidmet werden in neue Kommunikationsräume und aufgrund des Desksharing-Konzepts Arbeitsplätze wegfallen, entsteht oft die Frage, ob die Tische reichen. Was passiert an Tagen, wo mehr Menschen ins Büro kommen?
Zunächst gilt: Je mehr Abteilungen sich übergreifend am Desksharing beteiligen, um so besser lassen sich die Plätze effizient nutzen. Eine weitere Möglichkeit sind „Überlaufflächen“. Bereiche mit mehreren Arbeitsplätzen, vielleicht das oberste Staffelgeschoss mit Ausblick über die Stadt, wird als eine Art Co-Working-Space der gesamten Belegschaft geöffnet. Buchungen sind hier nicht möglich. Sollte es in den Homezones oder anderen Bereichen einmal eng werden oder hat jemand vergessen, einen Platz zu buchen, schaut man hier nach einem freien Platz.
3. Punktuelle Öffnungen für mehr „Flow“
Durchaus können Büroflure mit Zellenstrukturen einige Öffnungen vertragen. Das Büro neben der Teeküche wird durch einen Wanddurchbruch zur Cafeteria. Sofern noch nicht vorhanden, können Räume für mehr differenzierte Angebote (etwa oben genannte Projektbüros) zu Büros für 4-8 Personen verbunden werden. Türen können ausgehangen werden oder öfter offen stehen. Auch hierfür kann man Regeln vereinbaren: Offene Tür bedeutet: „Komm jederzeit rein und frag mich was!“ und kann z.B. für Mezzo-Büros als Standard vereinbart werden. Geschlossene Tür bedeutet: „Bitte nicht stören!“
Mehr Verbindung und Kommunikation kann auch durch Öffnungen zwischen benachbarten Büros erzeugt werden. Manchmal gibt es diese schon: Als klassischer „Behördengang“ mit Verbindungstüren zwischen den Arbeitsräumen. Abzuwägen ist hier der Mehrwert des Kommunikationsflusses ohne Umweg über den Flur gegen den zusätzlichen Platzbedarf paralleler Verkehrswege.
4. Flure nutzen
Vorbehaltlich der Brandschutzvorgaben können auch aus langen Fluren Begegnungsorte und Funktionsbereiche werden. Ein Board als Abstellfläche für die Kaffeetasse lädt zum schnellen Schnack oder Telefonat auf dem Flur ein. Eine Nische wird zum Treffpunkt. Die Wände dienen vielleicht als Brainstorming-Schreibfläche oder zeigen auf einem Gebäudeplan, wo sich heute welche Personen aufhalten. Auch Locker oder Telefonzellen können auf Fluren untergebracht werden.

5. Begegnung forcieren: Die Worklounge als Anlaufpunkt
Ein berechtigter Einwand bei Desksharing und wechselnden Arbeitsplätzen vor allem in Zellenstrukturen: Man trifft sich eher zufällig oder muss sich „zusammenbuchen“. Ein zentraler Anlaufpunkt kann das Zusammengehörigkeitsgefühl in der Firma oder in einer Abteilung unterstützen. Hier bietet sich die „Getränke-Quelle“ an, also eine erweiterte Teeküche mit Kaffeemaschine, Wasserspender, ggf. Kühlschrank usw. Die Teeküche muss dabei nicht mehr nur Pausenraum sein. Wenn hier ebenso die persönlichen Locker und Spinde platziert werden, die Druck- und Kopierstation und die Postfächer, dann gibt es vielfältige Gründe, vorbeizuschauen. Stehtische und Sitzmöbel laden dann nicht nur zum Pausen- oder Feierabend-Gespräch ein, sondern dienen auch lockeren Meetings nahe dem Kaffeeautomaten, einem Treffen mit externen Gästen oder der schnellen Absprache mit Service-Dienstleistern.
6. „Homezones“: Wie finde ich meine Leute und meine Akten?
Manchmal ist es nötig, das bestimmte Teams gut ansprechbar sind und man die jeweiligen Teammitglieder nicht im ganzen Haus suchen muss. Einige Teams arbeiten auch besonders eng zusammen oder benötigen eine spezielle Ausstattung, so dass ein weitverzweigtes Desksharing nicht sinnvoll ist. Dafür gibt es innerhalb des Desksharings das Konzept der „Homezones“. Ein Bereich mit Arbeitsplätzen ist dann einem Team fest zugeordnet; für die Effizienz können sich z.B. sechs Personen vier Arbeitsplätze teilen. Hilfreich ist das für feste Anlaufstellen, z.B. Assistenzen, das Facility Management (wenn häufig externe Firmen koordiniert werden müssen) oder für die Personalabteilung. Teams, die noch täglich mit Papierakten oder gedruckten Planunterlagen hantieren, möchten gern nah am Aktenstauraum sitzen. Auch hierfür sind „Heimatbereiche“ sinnvoll sowie gebündelte Aktenstellflächen als sogenannte Teamablagen. Akten sind dann zwar nicht mehr dem persönlichen Schreibtisch zugeordnet, befinden sich aber nah an den der Abteilung zugeordneten Arbeitsplätzen.
7. Probieren geht über Studieren
Veränderungen passieren nicht über Nacht. Umstellungen von klassischer Büroarbeit in Zellenbüros zu Activity-based Working und Desksharing können reibungsloser funktionieren, wenn Führungskräfte, Mitarbeitende, Planungsbüros und Organisationsberatungen Hand-in-Hand arbeiten und sich Meilensteine für die Veränderungen vornehmen. Konkrete Bedarfe und Arbeitsweisen müssen vorab gesammelt und analysiert werden. Probephasen ermöglichen Feedback und nachfolgende Anpassungen.
Der Vorteil der Umstellung auf Activity-Based Working in Verbindung mit Desksharing: Feste Büroarbeitsplätze werden im Rahmen von vermehrtem Remote-Arbeiten (HomeOffice) reduziert. Zudem können aufgrund der angebotenen Ausweichflächen und Sondernutzungen oft mehr Tische in ein Büro gestellt werden und somit noch mehr Räume für Sonderfunktionen genutzt werden. Diese Angebote für Sonderzonen sind attraktiv gestaltet, bieten die passende Umgebung für bestimmte Anforderungen und unterstützen Begegnung und Austausch. Es gibt infolge weniger leerstehende persönliche Büros und mehr Gründe, ins Büro zurückzukommen, um sich im Team auszutauschen.
Die Vorteile von herkömmlichen Zellenstrukturen: Akustische Abgeschlossenheit ist schon vorbereitet. Oft sind alle Anschlüsse für Büros in jedem Raum vorhanden – eine Rückwidmung einer Sofalounge oder eines agilen Meetingraums zu einem Büro ist also leicht möglich – viel leichter, als eine aufwändig geplante offene Bürolandschaft wieder umzugestalten oder neu aufzuteilen. Eine Umwidmung von Raumfunktionen sowie Renovierungen sind auch schrittweise möglich. Ebenso kann man Funktionen zwischen den Räumen leicht tauschen, sofern hauptsächlich bewegliche Möbel verwendet wurden.
Fazit
Das klassische Büro mit Einzelräumen ist kein Auslaufmodell, sondern eine wertvolle Ressource für zeitgemäße Arbeitsformen. Seine kleinteilige Struktur ermöglicht es, konzentrierte Zonen, Kommunikationsbereiche oder Projekträume mit wenig Aufwand einzurichten. Gleichzeitig lassen sich die unterschiedlichen Bedürfnisse der Mitarbeitenden besser berücksichtigen: Wer Ruhe sucht, kann sich zurückziehen, wer Austausch braucht, findet offene Begegnungsflächen. Damit entsteht eine gesündere Arbeitsumgebung, die Stress reduziert und Rücksicht auf Vertraulichkeit wie auch auf Erholungsphasen nimmt – ein deutlicher Vorteil gegenüber lauten, unübersichtlichen Großraumbüros. So wird vorhandene Bausubstanz zu einem flexiblen Fundament für eine zukunftsfähige, mitarbeiterorientierte Arbeitswelt.
raumdeuter ist ein Büro für Innenarchitektur mit dem Schwerpunkt Kommunikationsräume und neue Arbeitswelten. Wir brennen für interdisziplinär entwickeltes Corporate Design, Nachhaltigkeit und Teilhabe und arbeiten auch mit Agenturen für Organisationsberatung und Change-Management zusammen.
Zu unseren Büroprojekten geht es hier >>>